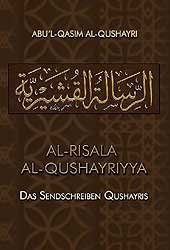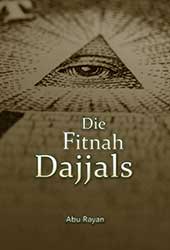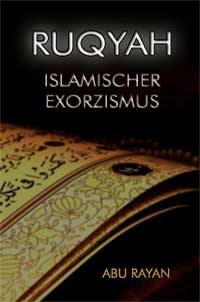Tauhid.net

Sei in der Welt wie ein Fremder
Autobiografischer Roman
Sich fremd fühlend im normalen deutschen Alltag, verlässt der Autor spontan seine Arbeitsstelle und schlägt sich nach Spanien durch. Aus philosophischen Gründen versucht er, sich aller materieller Dinge zu entledigen und legt tausende Kilometer zu Fuss, ohne Geld, Pass und Gepäck zurück, bis er schließlich in einem kleinen Einbaum mitten auf dem indischen Ozean seine wahre Identität findet.
Das Buch beschreibt den Versuch, den eigenen Eingebungen, dem inneren Führer, bedingungslos zu folgen. Die Eingebungen und äußeren Situationen vergleicht der Autor mit Wellen. Diese Wellen gilt es zu erkenen und "auf ihnen zu reiten", wenn sie ihn zu neuen Ufern tragen sollen, denn die rationale Analyse einer Situation und die logische Folgerung allein reichen niemals aus, um dem ständigen Fluss des Lebens und Gottes Willen gerecht zu werden. Wellenreiten wird ihm zum Symbol und er fängt es auch auf materieller Ebene an, um die Gesetze des Wellenreitens besser zu verstehen. Das verschlägt ihn schließlich auf eine Insel süd-westlich von Sumatra, wo es die höchsten Wellen der Welt gibt. Dort fällt ihm eine englische Übersetzung des Koran in die Hände, und die Wellen bekommen einen Namen: Hidaya.
Auf Umschlag klicken zum Download als pdf.
Bestellbar als
Taschenbuch bei amazon
(10,69 Euro, 368 S.) oder auch als kindle.
__________________
Bilder der Reise

So unbekannt und unbedeutend das Kaff ist, mittlerweile kommen erstaunlich viele Fremde vorbei und bleiben für ein paar Nächte. Das liegt daran, dass wir hier ein kleines Hotel aufgemacht haben und dieses gerne als Zwischenstopp von durchreisenden Ausländern genutzt wird.

Mit dem Teleskoparm eines riesigen Baukranes wurden die Teile der 40m hohen Regale zu den Männern gebracht, die in luftiger Höhe die Eisenstangen montierten. Andere Arbeiter waren dabei, Sprinkleranlagen zu installieren, und wieder andere schraubten an den gewaltigen Spezialkränen herum, die später computergesteuert die Regale mit Produkten wie Hundefutter, Fernsehern oder Rasierschaum füllen sollten.






Man hätte nie gedacht, nur eine halbe Stunde vom Zentrum einer Großstadt entfernt zu sein, denn das Einzige, was man von der Zivilisation mitbekam, waren die Kirchenglocken. Im Morgengrauen begannen die Vögel mit einem Konzert, ein kleiner Kiefernwald zog sich von der Höhle den Canyon hoch, die umliegenden Hügel waren mit Buschwerk, Kakteen und Agaven bewachsen, und man sah noch Umrisse der ältesten Höhlen.

Von einem Tag zum anderen, so schien es, verdorrte alles Gras auf den Hügeln und man wurde nun nicht mehr von dem Konzert der Vögel geweckt.

Das Zentrum von Cadiz besaß die urige Atmosphäre einer alten Hafenstadt, und auch das Schnorren lief hier ausgezeichnet, so dass ich mir Luxusgüter wie Haschisch und Schokoladencroissants leisten konnte.

In Tetouan führte er mich durch ein Labyrinth von kleinen Gassen und verwinkelten Plätzen, so dass ich bald völlig die Orientierung verloren hatte. Eine geheimnisvolle Welt, aber weil für mich undurchschaubar, auch irgendwie bedrohlich.



Ich kam durch endlose Wälder und ging den ganzen Tag, ohne ein Ende zu erreichen.



Die Höhle hatte drei Zimmer und einen Kamin, eine Terrasse und einen wunderbaren Panoramablick auf den Generalife und den Palast der Alhambra. Hinter der Terrasse fiel der Hang vier Meter steil ab.





Das alte Häuschen lag etwas abgelegen von der Siedlung und bestand nur aus einem Zimmer mit Kamin. Dahinter fing ein kleiner Eukalyptuswald an und ungefähr 100m weiter rauschte der Fluss Guadelfeo vorbei, meine eiskalte Badewanne.

Vor dem Häuschen befanden sich ein Feigenbaum, der zur Zeit wohlschmeckende Früchte trug, ein paar Granatapfelbäumchen und eine mit köstlichen Weintrauben überwachsene Terrasse. Die ganze Gegend war überdies voll mit Orangen-, Zitronen- und Mandelbäumen.

Am nächsten Vormittag ging ich wieder zum Hafen. Andere Passagiere kauften sich bereits ihr Ticket, Wagen standen in Reih und Glied, und LKWs und Container wurden schon aufgeladen.

Die Schlucht besaß eine karge, urzeitlich wirkende Vegetation. Hütten mit Palmendächern standen verstreut herum, das Meer warf seine Wogen auf weiße Sandsteinfelsen, und es gab einen kleinen kiesbedeckten Strand.

Von der Haltestelle, an der mich der Busfahrer herausließ, fiel eine schmale Straße steil zur Küste hin ab und gab den Blick schließlich auf einen mit schwarzen Kies bedeckten Strand frei: Playa del Socorro.


Ich baute eine rund 1,50m hohe Plattform vor die Höhle, suchte mir Stöcke und Palmwedel zusammen, und konstruierte mir ein Dach. Den Boden legte ich mit gefundenen Strandmatten aus: fertig war die Surfklause!



Der Bus hatte eine Panne und hielt kurz vor dem Tal von Valle Gran Rey. Statt auf einen Ersatzbus zu warten wie die anderen Passagiere, ging ich zu Fuß los, weil ich zu nervös war, um dort tatenlos herumzusitzen. Tief unten an der Küste sah man weiße Schaumränder, und ich wusste sofort, dass das hohe Wellen bedeutete.


Jeden Morgen bei Dämmerung ging ich die Küste entlang zu einer relativ einsamen Stelle, wo ich mir mit Kokosschalen einen runden Meditationsplatz abgesteckt hatte. Dort saß ich meist über eine Stunde lang und konzentrierte mich auf meine Atmung, obwohl Mücken anfingen, mich zu piesacken, und die Beine bereits nach einer halben Stunde schmerzten.